
Die Karriereseiten auf der WebSite
Nahezu kein potentieller Mitarbeiter bewirbt sich bei einem Unternehmen, ohne sich über dieses informiert zu haben. Eine zentrale Informationsquelle hierbei
Sie sind hier: Startseite » News » Stahl im Bauwesen

Nichtrostender Stahl – insbesondere Duplex-Stahl – bietet enorme Potenziale für nachhaltiges Bauen. Doch in vielen Bereichen steckt der Einsatz noch in den Kinderschuhen.
Stahl ist im Bauwesen weit mehr als ein altbewährter Baustoff. Er ist ein Schlüsselwerkstoff, dessen Entwicklung und Anwendung untrennbar mit dem Anspruch verbunden sind, ressourcenschonend, langlebig und wirtschaftlich zu bauen. Das wurde einmal mehr deutlich beim Fachseminar „Nichtrostender Stahl im Bauwesen“ an der Universität Duisburg-Essen. Organisiert in Kooperation mit der Informationsstelle Edelstahl Rostfrei (ISER) und der Forschungsvereinigung Stahlanwendung (FOSTA), bot die Veranstaltung ein eindrucksvolles Panorama aktueller Forschung und Praxis.
Im Zentrum stand die Frage, wie moderne nichtrostende Stahlsorten – allen voran Duplex-Stähle – zu einer nachhaltigeren Bauweise beitragen können. Diese Werkstoffe vereinen Eigenschaften, die für zukunftsorientierte Bauprojekte entscheidend sind: hohe Festigkeit, hervorragende Korrosionsbeständigkeit und eine nahezu verlustfreie Wiederverwertung.
Duplex-Stahl: Starke Argumente für eine nachhaltige Zukunft
Die technischen Vorteile von Duplex-Stählen sind seit Jahren bekannt, sie werden jedoch im bauaufsichtlich geregelten Bereich erst nach und nach genutzt. Ihr zweiphasiges Gefüge aus Austenit und Ferrit ermöglicht eine hohe mechanische Festigkeit (Rp0,2 oft >400 MPa) bei gleichzeitig hoher Zähigkeit – eine Kombination, die klassischen Baustählen überlegen ist. Damit lassen sich Konstruktionen mit dünneren Wanddicken realisieren, was Material und Gewicht spart und folglich Transport- und Montageaufwände reduziert. Auch die Korrosionsbeständigkeit ist durch die Bildung einer passiven Chromoxidschicht beeindruckend: Während konventionelle Baustähle aufwändig geschützt und regelmäßig saniert werden müssen, bleibt Duplex-Stahl in vielen Anwendungen jahrzehntelang nahezu wartungsfrei.
Recyclingfähigkeit und Ressourceneffizienz
Ein weiterer, wichtiger Aspekt betrifft die Kreislaufwirtschaft: Bis zu 95 % des in Europa eingesetzten nichtrostenden Stahls basieren auf Schrott. Nach Nutzungsende lässt sich der Werkstoff praktisch vollständig wiederverwerten. Diese Eigenschaften sind in einer Zeit, in der Lebenszyklusanalysen, CO₂-Bilanzen und Umweltwirkungen immer mehr Ausschreibungen prägen, ein entscheidender Wettbewerbsvorteil.
Prof. Dr.-Ing. Natalie Stranghöner (Universität Duisburg-Essen) zeigte, dass sich die Normenlandschaft ebenfalls weiterentwickelt: Die zweite Generation der EN 1993-1-4 wird künftig noch präzisere Vorgaben für nichtrostende Stähle enthalten – etwa zur Bemessung kaltverfestigter Profile, zu Festigkeitssteigerungen und zu verlässlichen Klassifizierungen der Korrosionsbeständigkeit. Die Anforderungen an die Nachweise steigen, gleichzeitig werden jedoch wirtschaftlichere Lösungen möglich, da die Potenziale moderner Werkstoffe normativ besser abgebildet werden.
Normung, Wissenstransfer und gemeinsame Verantwortung
Die langjährige enge Kooperation zwischen dem Bundesverband Metall und der Universität Duisburg-Essen bildet dafür eine tragende Säule. Gemeinsam engagieren sich die Institutionen in relevanten nationalen und internationalen Normungsgremien, von den Eurocodes über die DIN EN 1090 bis hin zu Sonderregelungen der abZ und abG. Dieses Engagement hat in den letzten Jahren dazu beigetragen, die Akzeptanz neuer Werkstoffe in der Praxis zu fördern und verlässliche Rahmenbedingungen für Planer und Verarbeiter zu schaffen.
Gerade in komplexen Einsatzumgebungen – etwa Brückenbauwerken, Tunneln oder Fassadenkonstruktionen in maritimer Atmosphäre – ist die Kombination aus normativem Wissen, praktischer Erfahrung und kontinuierlicher Weiterbildung entscheidend.
Herausforderungen der Anwendung
Gleichwohl darf nicht verschwiegen werden, dass die Verarbeitung von Duplex-Stählen besondere Anforderungen stellt. Hochlegierte Werkstoffe erfordern qualifizierte Schweißtechnik, exakte Bemessung und ein sensibles Verständnis für die Wechselwirkungen von Material, Konstruktion und Umgebungseinflüssen. Wie Dr. Sebastian Heimann (ISER) in seinem Beitrag hervorhob, ist Korrosionsbeständigkeit keine bloße Materialeigenschaft, sondern eine Systemeigenschaft: Nur wenn Planung, Werkstoffauswahl, Verarbeitung und Instandhaltung aufeinander abgestimmt sind, lässt sich das volle Potenzial ausschöpfen. Ein falsches Detail – wie unzureichend gereinigte Schweißnähte oder nicht abgestimmte Befestigungsmittel – kann die theoretisch hohe Lebensdauer drastisch verkürzen.
Autor:
Thomas Röper (B.Eng.)
Technischer Berater in der Fachberatungs- und Informationsstelle beim Bundesverband Metall in Essen
Mail: thomas.roeper@metallhandwerk.de

Nahezu kein potentieller Mitarbeiter bewirbt sich bei einem Unternehmen, ohne sich über dieses informiert zu haben. Eine zentrale Informationsquelle hierbei

Ein Webinar mit in der Praxis bewährten KI gestützten Kompaktlösungen, die Sie ab morgen in Ihrer Berufspraxis wertschöpfend einsetzen können.
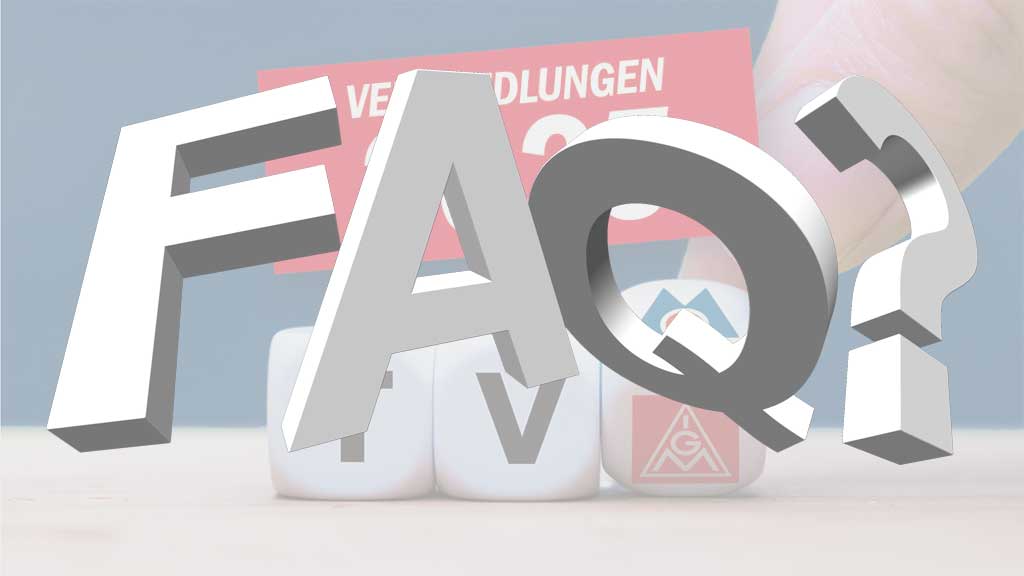
Der demografische Wandel und der zunehmende Fachkräftemangel stellen viele Betriebe vor große Herausforderungen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Beschäftigten, die

Mit dem nunmehr komplettierten Metaller-Test für die Metallbauer geben wir für die ausbildenden Kolleginnen und Kollegen ein wenig Schützenhilfe. Zwar

Seit 25 Jahren verbindet Metall & mehr Clubmitglieder und Rahmenvertragspartner zu einer starken Gemeinschaft. Wie bei einer Kette zählt jedes

Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland ist unverändert geblieben. Der ifo Geschäftsklimaindex verharrte im Januar bei 87,6 Punkten. Die
Der Fachverband Metall NW verlost unter den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben zehn mal 1 Exemplar “Dübel Handbuch 4.0”. An der Verlosung nimmt jeder Teil, der seinen Namen, seine postalische Adresse sowie seine E-Mail-Adresse bis zum Einsendeschluss am 07.11.2025 zusendet. Dies kann über das Formular auf dieser Website oder per E-Mail an fvm@metallhandwerk-nrw.de mit dem Betreff “Verlosung Dübelhandbuch 4.0” geschehen.
Die zehn Gewinner werden unter den Teilnehmenden durch Los ermittelt. Sie werden per E-Mail über den Gewinn informiert.
Die Gewinner werden auf unserer Website mit vollständigen Namen genannt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Namens einverstanden.
Soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, erfolgt die Verarbeitung und Speicherung auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Die Daten werden 1 Jahr nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. Die Gewinner haben das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer Daten sowie Berichtigung oder Löschung ihrer Daten zu verlangen. Weiterhin steht ihnen ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung ihrer Daten zu. Weitere Informationen darüber finden sich in unserer Datenschutzerklärung.
Der Fachverband Metall NW verlost unter den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben fünf mal ein Exemplar des Buchs „Weiße Rhetorik” von Wladislaw Jachtchenko. An der Verlosung nimmt jeder Teil, der seinen Namen, seine postalische Adresse sowie seine E-Mail-Adresse bis zum Einsendeschluss am 10.10.2025 zusendet. Dies kann über das Formular auf dieser Website oder per E-Mail an fvm@metallhandwerk-nrw.de mit dem Betreff “Verlosung Weiße Rhetorik” geschehen.
Die fünf Gewinner werden unter den Teilnehmenden durch Los ermittelt. Sie werden per E-Mail über den Gewinn informiert.
Die Gewinner werden auf unserer Website mit vollständigen Namen genannt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Namens einverstanden.
Soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, erfolgt die Verarbeitung und Speicherung auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Die Daten werden 1 Jahr nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. Die Gewinner haben das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer Daten sowie Berichtigung oder Löschung ihrer Daten zu verlangen. Weiterhin steht ihnen ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung ihrer Daten zu. Weitere Informationen darüber finden sich in unserer Datenschutzerklärung.
Der Fachverband Metall NW verlost unter den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben fünf mal ein Exemplar des Buchs „Dunkle Rhetorik” von Wladislaw Jachtchenko. An der Verlosung nimmt jeder Teil, der seinen Namen, seine postalische Adresse sowie seine E-Mail-Adresse bis zum Einsendeschluss am 08.08.2025 zusendet. Dies kann über das Formular auf dieser Website oder per E-Mail an fvm@metallhandwerk-nrw.de mit dem Betreff “Verlosung Dunkle Rhetorik” geschehen.
Die fünf Gewinner werden unter den Teilnehmenden durch Los ermittelt. Sie werden per E-Mail über den Gewinn informiert.
Die Gewinner werden auf unserer Website mit vollständigen Namen genannt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Namens einverstanden.
Soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, erfolgt die Verarbeitung und Speicherung auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Die Daten werden 1 Jahr nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. Die Gewinner haben das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer Daten sowie Berichtigung oder Löschung ihrer Daten zu verlangen. Weiterhin steht ihnen ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung ihrer Daten zu. Weitere Informationen darüber finden sich in unserer Datenschutzerklärung.
Der Fachverband Metall NW verlost unter den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben fünf mal ein Exemplar des Buchs „Schäden im Metallbau 3” von Jörg Dombrowski. An der Verlosung nimmt jeder Teil, der seinen Namen, seine postalische Adresse sowie seine E-Mail-Adresse bis zum Einsendeschluss am 11.07.2025 zusendet. Dies kann über das Formular auf dieser Website oder per E-Mail an fvm@metallhandwerk-nrw.de mit dem Betreff “Verlosung Schäden im Metallbau 3” geschehen.
Die fünf Gewinner werden unter den Teilnehmenden durch Los ermittelt. Sie werden per E-Mail über den Gewinn informiert.
Die Gewinner werden auf unserer Website mit vollständigen Namen genannt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Namens einverstanden.
Soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, erfolgt die Verarbeitung und Speicherung auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Die Daten werden 1 Jahr nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. Die Gewinner haben das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer Daten sowie Berichtigung oder Löschung ihrer Daten zu verlangen. Weiterhin steht ihnen ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung ihrer Daten zu. Weitere Informationen darüber finden sich in unserer Datenschutzerklärung.
Der Fachverband Metall NW verlost unter den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben fünf mal eine Halbjahres-Lizenz für “MetallStat”. An der Verlosung nimmt jeder Teil, der seinen Namen, seine postalische Adresse sowie seine E-Mail-Adresse bis zum Einsendeschluss am 10.06.2025 zusendet. Dies kann über das Formular auf dieser Website oder per E-Mail an fvm@metallhandwerk-nrw.de mit dem Betreff “Verlosung MetallStat” geschehen.
Die fünf Gewinner werden unter den Teilnehmenden durch Los ermittelt. Sie werden per E-Mail über den Gewinn informiert.
Die Gewinner werden auf unserer Website mit vollständigen Namen genannt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Namens einverstanden.
Soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, erfolgt die Verarbeitung und Speicherung auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Die Daten werden 1 Jahr nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. Die Gewinner haben das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer Daten sowie Berichtigung oder Löschung ihrer Daten zu verlangen. Weiterhin steht ihnen ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung ihrer Daten zu. Weitere Informationen darüber finden sich in unserer Datenschutzerklärung.
Der Fachverband Metall NW verlost unter den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben zehn mal 1 Exemplar “Englisch für Metallbauer”. An der Verlosung nimmt jeder Teil, der seinen Namen, seine postalische Adresse sowie seine E-Mail-Adresse bis zum Einsendeschluss am 09.05.2025 zusendet. Dies kann über das Formular auf dieser Website oder per E-Mail an fvm@metallhandwerk-nrw.de mit dem Betreff “Verlosung Englisch für Metallbauer” geschehen.
Die zehn Gewinner werden unter den Teilnehmenden durch Los ermittelt. Sie werden per E-Mail über den Gewinn informiert.
Die Gewinner werden auf unserer Website mit vollständigen Namen genannt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Namens einverstanden.
Soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, erfolgt die Verarbeitung und Speicherung auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Die Daten werden 1 Jahr nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. Die Gewinner haben das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer Daten sowie Berichtigung oder Löschung ihrer Daten zu verlangen. Weiterhin steht ihnen ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung ihrer Daten zu. Weitere Informationen darüber finden sich in unserer Datenschutzerklärung.
Der Fachverband Metall NW verlost unter den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben fünf mal “Tabellenbuch für Metallbautechnik”. An der Verlosung nimmt jeder Teil, der seinen Namen, seine postalische Adresse sowie seine E-Mail-Adresse bis zum Einsendeschluss am 06.02.2026 zusendet. Dies kann über das Formular auf dieser Website oder per E-Mail an fvm@metallhandwerk-nrw.de mit dem Betreff “Verlosung Tabellenbuch für Metallbautechnik” geschehen.
Die fünf Gewinner werden unter den Teilnehmenden durch Los ermittelt. Sie werden per E-Mail über den Gewinn informiert.
Die Gewinner werden auf unserer Website mit vollständigen Namen genannt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Namens einverstanden.
Soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, erfolgt die Verarbeitung und Speicherung auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Die Daten werden 1 Jahr nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. Die Gewinner haben das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer Daten sowie Berichtigung oder Löschung ihrer Daten zu verlangen. Weiterhin steht ihnen ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung ihrer Daten zu. Weitere Informationen darüber finden sich in unserer Datenschutzerklärung.
Der Fachverband Metall NW verlost unter den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben weitere Exemplare des Buchs „ZINQ Planer 2026”. An der Verlosung nimmt jeder Teil, der seinen Namen, seine postalische Adresse sowie seine E-Mail-Adresse bis zum Einsendeschluss am 16.01.2026 zusendet. Dies kann über das Formular auf dieser Website oder per E-Mail an fvm@metallhandwerk-nrw.de mit dem Betreff “Verlosung ZINQ Planer” geschehen.
Die Gewinner werden unter den Teilnehmenden durch Los ermittelt. Sie werden per E-Mail über den Gewinn informiert.
Die Gewinner werden auf unserer Website mit vollständigen Namen genannt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Namens einverstanden.
Soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, erfolgt die Verarbeitung und Speicherung auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Die Daten werden 1 Jahr nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. Die Gewinner haben das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer Daten sowie Berichtigung oder Löschung ihrer Daten zu verlangen. Weiterhin steht ihnen ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung ihrer Daten zu. Weitere Informationen darüber finden sich in unserer Datenschutzerklärung.
Der Fachverband Metall NW verlost unter den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben jeweils 1x
An der Verlosung nimmt jeder teil, der seinen Namen, seine postalische Adresse sowie seine E-Mail-Adresse bis zum Einsendeschluss am 07.02.2025 zusendet. Dies kann über das Formular auf dieser Website oder per E-Mail an fvm@metallhandwerk-nrw.de mit dem Betreff “Verlosung Januar2025” geschehen.
Der Teilnehmer wählt selbst, für welchen Preis er an der Verlosung teilnehmen möchte. Mehrfachteilnahme ist möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Die Gewinner werden für jeden Preis getrennt unter den Teilnehmenden durch Los ermittelt. Sie werden per E-Mail über den Gewinn informiert.
Die Gewinner werden auf unserer Website mit vollständigen Namen genannt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Namens einverstanden.
Soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, erfolgt die Verarbeitung und Speicherung auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Die Daten werden 1 Jahr nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. Die Gewinner haben das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer Daten sowie Berichtigung oder Löschung ihrer Daten zu verlangen. Weiterhin steht ihnen ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung ihrer Daten zu. Weitere Informationen darüber finden sich in unserer Datenschutzerklärung.
Der Fachverband Metall NW verlost unter den teilnehmenden Mitgliedsbetrieben 25 mal ein Exemplar des „ZINQ Planer 2025”. An der Verlosung nimmt jeder Teil, der seinen Namen, seine postalische Adresse sowie seine E-Mail-Adresse bis zum Einsendeschluss am 15.12.2024 zusendet. Dies kann über das Formular auf dieser Website oder per E-Mail an fvm@metallhandwerk-nrw.de mit dem Betreff “Verlosung ZINQ Planer 2025” geschehen.
Die 25 Gewinner werden unter den Teilnehmenden durch Los ermittelt. Sie werden per E-Mail über den Gewinn informiert.
Die Gewinner werden auf unserer Website mit vollständigen Namen genannt. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklären Sie sich mit der Veröffentlichung Ihres Namens einverstanden.
Soweit es sich um personenbezogene Daten handelt, erfolgt die Verarbeitung und Speicherung auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. Die Daten werden 1 Jahr nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht. Die Gewinner haben das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer Daten sowie Berichtigung oder Löschung ihrer Daten zu verlangen. Weiterhin steht ihnen ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung ihrer Daten zu. Weitere Informationen darüber finden sich in unserer Datenschutzerklärung.